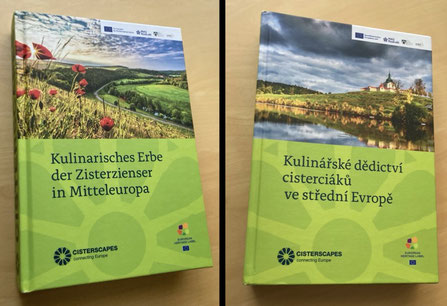
In mehrfacher Hinsicht „kulinarisch“ wurde der Band gestaltet, der nun als Begleitpublikation des EU-Kooperationsprojekts „Kulinarisches Erbe der Zisterzienser“ erschienen ist. Die rund 300 Seiten sind nicht fachwissenschaftlich ausgerichtet, sondern als Kulturvermittlung für ein interessiertes Laienpublikum. Viele ansprechende Illustrationen (teils Bildquellen, teils Fotografien von Landschaften und von Speisen; meist rechts auf die Aufschlagseite gesetzt) steigern die Motivation, sich in das Buch zu vertiefen. Der Band ist als Wendebuch gestaltet. Von der einen Seite her ist der deutschsprachige, von der anderen der inhaltlich wohl identische tschechische Teil zu lesen – eine Lösung, die auch für andere künftige deutsch-tschechische Projekte zu wünschen ist.
Auf einen einleitenden Abschnitt folgen Ausführungen über Fischzucht, Bier, Wein, Obst und andere Produkte zisterziensischer Lebensmittel-Wirtschaft. Hier wurde auf große geographische Breite und die Würdigung möglichst vieler am Cisterscapes-Projekt beteiligter Klosterorte und weiterer Zisterzienserklöster Wert gelegt, von Salem bis Žďár, von Loccum bis Stams. Die Oberpfalz ist in Bild (S. 32f., 39) und Wort („Prägende Teichwirtschaft“, S. 38) durch das Waldsassener Stiftland vertreten.
Unter der Überschrift „Kochen wie die Zisterzienser“ wird anschließend ein Rezeptteil präsentiert, entnommen dem „Koch-Buch So wol Für geistliche als auch Weltliche grosse und geringe Haußhaltungen“, verfasst von Bernardin Buchinger OCist (1606–73; im angezeigten Band irrtümlich jeweils „Bernhard“), Abt im elsässischen Lützel. Man kann so seine „Krebs-Knöpflin“, „Manus Christi Täffelin“, sein „Hirschen Wildprät“ und anderes am eigenen Herd nachkochen.
Das Hauptanliegen der Publikation ist unter der Überschrift „Öffentlichkeitsvermittlung“ in einem eigenen, abschließenden Abschnitt entfaltet: „Im Rahmen unseres Projekts wurden mehrere Varianten von Bildungsprogrammen für unterschiedliche Zielgruppen und Einsatzorte erprobt.“ (S. 136) In Kurzberichten werden verschiedene dieser konkreten Aktionen vorgestellt, durch die die interessierte Öffentlichkeit mit der Klosterkulinarik in Kontakt kommen konnte. So wurden den Besucherinnen und Besuchern des „Street Food Festival Žďár“ 2023 „neben köstlichen Gerichten“ (aus Buchingers Kochbuch) „auch lehrreiche Erkenntnisse aus der Geschichte serviert“ (S. 118). Der Plan ging wohl auf: Essen eignet sich „besonders gut, Interesse an weiterführenden Themen zu wecken. Denn es ist niederschwellig, spricht verschiedene Sinne an und macht einfach Spaß.“ (S. 120)
„Allen voran die Zisterzienser“ ist ein nicht nur implizites Motto des Buches (s. S. 56), ein anderes: „natürlich alles streng historisch“ (S. 124). An vielen Stellen wären aber Skepsis und historische Relativierungen angebracht. Dass die Zisterzienser etwas taten und dass sie es gut taten, heißt nicht zwangsläufig, dass es in anderen Orden nicht auch gebräuchlich war. Die Tragfähigkeit mutmaßlicher Alleinstellungsmerkmale wäre auf den Vergleich angewiesen. Zumindest für die Frühe Neuzeit steckt die vergleichende Ordensforschung allerdings noch in den Kinderschuhen. Buchingers „Koch-Buch“ jedenfalls ist kaum als Abbild einer spezifisch zisterziensischen Küche anzusehen, sondern eher als Manual für das lesefähige Küchenpersonal beliebiger Herrschaften – dies verrät ja schon der Untertitel.
Deutlich wird das unscharfe Wording beispielsweise auch beim Thema „Orangerien bei den Zisterziensern“ (S. 70f.) mit der irreführenden Aussage: „Der Anblick einer Orange im winterlichen Mitteleuropa [...] zeigte, wie weit das Wissen der Zisterzienser reichte“ (S. 70). Korrekt wäre die Aussage: „[...] wie weit das Wissen der Klöster in der Barockzeit reichte“. Denn der Orden von Cîteaux fügte sich hier in einen Trend ein, dem andere Gemeinschaften gleichermaßen folgten. Nicht „[d]ie Zisterzienser“, sondern Mönche überhaupt und auch Chorherren „setzten dabei [...] auf technische Beherrschbarkeit und botanische Neugier. Ihre Orangerien waren [...] Prestigeobjekte innerhalb eines europaweiten Netzwerks klösterlicher Expertise“ (S. 71). In Sachen Wein- und Obstanbau dürfte das quantitative und qualitative Ranking zwischen den vormodernen Prälatenorden Mitteleuropas ebenfalls noch nicht entschieden sein.
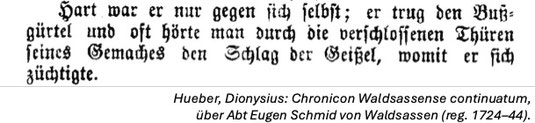
Zu hinterfragen sind außerdem allerlei Pauschalisierungen, etwa die, bei den Zisterziensern würden „Geist und Körper als gleichwertig“ gelten (S. 12) – offenbar eine Rückprojektion heutigen Zeitgeists, aber keinesfalls eine vormoderne Tatsache. „Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit“ (S. 14) gehören heute zum Standard-Vokabular der Vermarktung von Öko-Produkten. Vor dem Zeitalter von Agrar-Technisierung und globalisiertem Lebensmittelhandel waren dies aber „alternativlose“ Produktionsbedingungen: Wer gegen die Gesetze der Natur im unmittelbaren Lebensumfeld gewirtschaftet hätte, wäre zwangsläufig dem Hunger verfallen. Im Wirtschaftsrecht gilt die „Werbung mit Selbstverständlichkeiten“, vorsichtig ausgedrückt, als heikel. Davon ist die Publikation manchmal nicht sehr weit entfernt.
Fazit: Der Band vermittelt opulente Eindrücke zisterziensischer Kulinarik von den Anfängen bis zur Gegenwart. Er weckt durch Texte und Illustrationen die Lust zu lesen und zu essen. Dadurch fördert er Sympathien für die zisterziensische Sphäre. Dabei greift er viele wirtschaftsgeschichtliche Fakten auf, fügt sie aber nicht unbedingt zu einem stimmigen historischen Gesamtbild zusammen. Zwischen Ideal und Wirklichkeit wird oft nicht trennscharf unterschieden. Der Charakter der Publikation ist so eher motivierend als informierend. Er dient der Werbung für die „Marke Zisterzienser“. Insofern ist er jedenfalls sehr geeignet, weiteres Interesse an Ordensgeschichte und Klosterkultur zu wecken. Womöglich kann er auch als Anregung dienen, die vergleichende Ordensforschung zu intensivieren.
Interessierte können den Band demnächst im Waldsassener Cisterscapes-Büro (Johannisplatz 5) gratis erwerben.
Lit.:
Kulinarisches Erbe der Zisterzienser in Mitteleuropa. Kulinářské dědictví cisterciáků ve střední Evropě, o. O. 2025.
